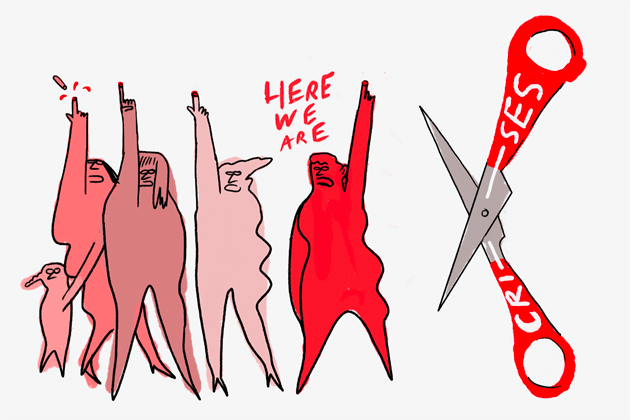Büsra Delikaya plädiert für einen Freiheitsbegriff, der tatsächlich alle Menschen umfasst. Denn sie glaubt, dass durch Corona die Widerstandsfähigkeit gesellschaftlicher Solidarität auf die Probe gestellt wird. Und dass wir uns dringend mit der Kluft zwischen den sozialen Klassen beschäftigen müssen.
Von Büsra Delikaya, 15.06.2020Die letzten Wochen und Monate sind eine so vehemente Verwirklichung des modernen Krisenbegriffs, dass wir auch unseren gesellschaftlichen Verbleib neu diskutieren mussten. Es galt immens viel abzuwägen, zu debattieren und besprechen, zu diskutieren und befragen. Zweifeln und Aufklären waren gegenläufige Begleiter. Stündlich hangelte man sich von einem Dissens zum anderen. Und mittendrin das ewige Warten.
So verstrich die anfängliche Spannung und das Absitzen der unabsehbaren Zeit vor der ersehnten Normalität ließ eine träge Akzeptanz aufkommen. Es war von Anfang an ein Zustand jenseits der Normalität, in dem wir nun seit geraumer Zeit durch vage Tage schaukeln. Das gewohnte Leben bleibt vielerorts noch immer aus, die neue Norm besteht aus immer neuen Umstrukturierungen. Noch immer werden auf regelmäßigen Pressekonferenzen Regierungsbeschlüsse verlautbart. Ständig melden sich politische Akteure über soziale Medien zu Wort, während amtierende Abgeordnete die Ein- und Ausführung einzelner Maßnahmen diskutieren. Kinder gehen inzwischen immerhin tageweise wieder in Kitas und Schulen, Spielplätze haben gerade erst wieder geöffnet, die Gastronomie strauchelt – und es fühlt sich noch immer so an, als wäre vor das rege Leben Berlins ein Riegel geschoben worden.
Dieser Tage schienen vor allem politische Vakanz und Verdrossenheit an Bedeutung zu verlieren. Nicht aber die Pluralität der Bevölkerung, auch nicht die Transparenz politischen Handelns, noch weniger aber der Raum für Debatten: Öffentlich und privat werden die Verhältnisse unter stets neuen Vorzeichen diskutiert. Erleichtert kann man beobachten, dass die Presse sich dem Thema in oftmals fundierten wie kritischen Beiträgen widmet. Es waren Journalist*innen, die sich von Beginn der Krise an in nüchterner Betrachtung und mit kritischem Ton an die Öffentlichkeit wandten, um vernachlässigten Diskursen mehr Reichweite zu verschaffen. Um konträre Perspektiven nachzuzeichnen, ja auch, um für Vorsicht und Besonnenheit im Umgang mit den durch Corona bedingten Entwicklungen zu plädieren. Es waren auch Journalist*innen, die strikte Forderungen nach sofortigen Ausgangssperren anmahnten, als sich nicht wenige Bürger*innen einer Panikstimmung hingaben.
Doch sah es teilweise auch so aus, als fühlte sich die staatliche Autorität mit einem Freifahrtschein ausgestattet. Videosequenzen, die größere Gruppen im öffentlichen Raum zeigten und als Rechtfertigung für deren Ächtung dienten, landeten zuhauf im Netz. Ebenso Fotos von Menschen ohne Masken und mit nicht anonymisiertem Gesicht, damit zu sehen war, wer sich auf welche Weise nicht an Regeln hielt. Diese Bilder wirkten wie virtuelle Zeigefinger, die sich über die Timelines etlicher User*innen zogen, um nichts als destruktive Diskussionen zu forcieren – ähnlich schrill wie all die Menschen, die für eine allgemeine Ausgangssperre lautstark in den Vordergrund traten. Mit Blick auf die außergewöhnlichen Umstände war das zwar nachvollziehbar, aber – so entschied die Regierung letztendlich – nicht gerechtfertigt. Neben Journalist*innen und den Stimmen besonnener Bürger*innen war es die Bundeskanzlerin selbst, die implizit zum kritischen Denken anhielt. Die sich expressis verbis für die Einführung von Maßnahmen unter genauer Abwägung ihrer Dringlichkeit aussprach.
Erwartungen an die Politik stiegen parallel zum Verlauf der Kurve an. Sobald diese abflachte, hielten viele die Krise fälschlicherweise für überstanden. Fortwährende Maßnahmen wurden lästig, erschienen unnötig, wurden von Dilettant*innen willkürlich verfälscht. Die auf bürgerliche Freiheiten bedachte Wachsamkeit über politisches Handeln begann von kruden Verschwörungstheorien überschattet zu werden. Parallel entstand ein ausgeprägter Gegenpol, der in konspirativen und meist rechten Ideologien kulminierte.
Tatsächlich besteht nun die Gefahr, berechtigte und für eine Demokratie überlebenswichtige Kritik (z. B. gegenüber Tracking-Apps) nur als Produkt von Ignoranz und Bildungsferne wahrzunehmen. Diese fehlende Genauigkeit führt nicht allein dazu, dass der politischen Mündigkeit einzelner Bürger*innen Unrecht getan wird. Es relativiert auch den sozial übergreifenden Zulauf im Verschwörungsmilieu. Denn nicht immer sind es bildungsferne Bürger*innen, die den sogenannten Theorien über Gates & Co. Glauben schenken. Es sind auch Menschen, die Zugang zu fundiertem Wissen und aufklärerischen Ideen haben. Konspirative Bewegungen ziehen ihre Kraft oft schlicht aus bestimmten Feindbildern, die historisch-kontextuell immer wieder changieren.
Das Fundament einer resilienten Gesellschaft aber bleibt die Bereitschaft zu einem am Gemeinwohl orientierten, kollektivistischen Denken. Zu einer Demokratie gehört neben dem Pluralismus auch ein mehr oder weniger einheitliches Wertesystem. Und die Aufgabe eines freiheitlich-demokratischen Landes ist es nicht, ausnahmslos jeden mitzunehmen, sondern nur diejenigen, die gemeinsame Grundsätze achten, anstatt durch stereotypisierende Haltungen Fronten zu eröffnen und zu verhärten.
Ein gegen Geflüchtete hetzender Popsänger wie Xavier Naidoo, der den ohnehin unaufhörlich wachsenden Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus befeuert, bedient sich nicht der Meinungsfreiheit zugunsten der Demokratie, sondern des Populismus zugunsten rechter Ideolog*innen. Gänzliches Misstrauen gegenüber der Regierung bedeutet eine Kehrtwende in Richtung identitärer Strömungen – das Auffangbecken für politische Verbitterung und ideologischen Hass schlechthin. Doch Deutschland ist beileibe kein Land, das sich einen Aussetzer im Denken von Gemeinschaftlichkeit leisten kann, erst recht kein Verlassen der demokratischen Grundhaltung.
Derzeit wird hier mit Begriffen wie Diktatur und Regime um sich geworfen, in einem Land, das zwischen 1933 und 1945 den schlimmsten Auswüchsen einer Diktatur Raum gegeben hat. Mit Angst vor „Zwangsimpfungen“ und anderen Repressalien wird bei Demonstrationen gegen einen angeblich neu erwachenden Faschismus argumentiert. In einem Land, das sich in jüngster Vergangenheit in den öffentlichen Reaktionen auf rechtsextreme Angriffe in Halle und Hanau an Unbeholfenheit nicht überbieten ließ.
Ein weiteres, großes Problem scheint mir der symptomatische Egoismus zu sein, der dringend überwunden werden muss. Denn ob wir wollen oder nicht: Wir sind Teil eines großen gesellschaftlichen Kollektivs. Vertrauen in die Politik heißt nicht, passiv zu bleiben und den eigenen Verstand auszuschalten. Vertrauen in die Politik heißt, auf das Grundgerüst der Demokratie zu setzen und die Entwicklungen in ihrem Namen zu beobachten und mitzugestalten. Demokratie schließt Partizipation nicht aus, sie beruht darauf. Genauso wie sie auf vernunftbasierten Entschlüssen beruht. So werden Grundrechte nicht gegeneinander ausgespielt, wenn das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Versammlungsfreiheit vorgezogen wird. Sie werden gegeneinander abgewogen und nach Verhältnismäßigkeit priorisiert.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wurde für die von vielen als rechtzeitig und angemessen strikt wahrgenommenen Maßnahmen im Übermaß gerühmt. Vergessen war seine erzkonservative Haltung zu kontroversen Themen, auch seine geringschätzige Umschreibung der Situation von Flüchtenden, die er in einem Statement von 2018 mit „Aslytourismus“ umschrieb. Erst vor drei Monaten stellte Söder sich entschieden gegen die Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland in Deutschland. Inzwischen sind es fast 40.000 Menschen, die auf griechischen Inseln unter unwürdigen Bedingungen zwischen Ungewissheit und Angst ausharren.
Der Grund, weshalb Politiker*innen wie Söder innerhalb der Krise trotz allem gefeiert werden, geht mit der Neuen Sozialen Frage einher. Die Frage, die sich für gewöhnlich hierzulande stellt, ist die nach Freiheit und Sicherheit für deutsche Bürger*innen, nicht aber die nach einem allumfassenden Freiheitsbegriff. Nach diesem wird kaum gesucht, es scheint den meisten zu genügen, wenn die eigene Freiheit und Sicherheit gewährleistet sind. Wer aber bleibt dabei auf der Strecke? Wenn diese Frage zweitrangig bleibt, dann sehe ich die demokratischen Werte Gefahr laufen, durch Hierarchien abgelöst zu werden, in denen beispielsweise Heimatlose und Menschen ohne oder mit nur schlecht bezahlter Arbeit keine Stimme haben und den Privilegiertesten das Mikrofon gereicht wird.
Stumm bleiben wieder einmal die sozial Unsichtbaren. Stumm sind sie auch geblieben, als sie buchstäblich beklatscht wurden, weil sie in den vergangenen Wochen eine Arbeit taten, deren Bedingungen jahrelang zu Recht Streikwellen auslösten. Sichtbar waren sie nur dort, wo die Mitte der Gesellschaft Galionsfiguren für die zermürbende Krise brauchte. Kaum beachtet wurden und werden darüber die sozialen Realitäten von Alleinerziehenden, vereinsamten Älteren oder Frauen in Gewaltehen. Von Obdachlosen, unterbezahlten Schichtarbeiter*innen oder psychisch Erkrankten. Auch nicht die der sogenannten „Gastarbeiter*innen“, die noch immer Schwerstarbeit verrichten und wie viele andere keine Aussicht auf Homeoffice haben – womöglich nicht einmal mehr Aussicht auf künftige Arbeit. In Zeiten der Krise wird nicht nur die Widerstandsfähigkeit von Solidarität und Gemeinschaft auf die Probe gestellt, sondern eben auch die Kluft zwischen den sozialen Klassen deutlich. Und vor allem das muss uns dieser Tage beschäftigen.
+++
Dieser Essay wurde ausgewählt aus 40 weiteren Beiträgen, die uns im Rahmen unseres Wettbewerbs „Erkundungen im Maschinenraum der Demokratie“ zugesendet wurden, um sich mit den Themen Demokratie und Grundgesetz vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 2020 auseinanderzusetzen.
Drei weitere ausgewählte Essays können Sie hier nachlesen.
Der Wettbewerb entstand im Rahmen des Projekts Demokratie? Eine Frage der Verfassung! unter der Projektleitung der Soziologin Uta Rüchel in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld (Professur für Zeitgeschichte) und der Robert-Havemann-Gesellschaft. Das Projekt von WIR MACHEN DAS wird gefördert von der Bundeszentrale für Politische Bildung.