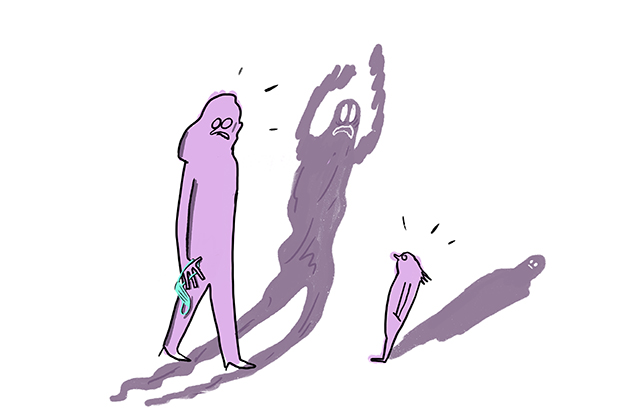Die Angst vor dem Unbekannten, dem Unberechenbaren verbindet in Zeiten von Corona nahezu alle. Die Einschränkungen jedoch, unter denen die Gesellschaft derzeit leidet, kennen viele Menschen auch ohne Pandemie. Darüber, wer sich in Krisenzeiten Gehör verschafft und wessen Ängste im Vordergrund stehen, schreibt Iskandar Ahmad Abdalla.
Von Iskandar Ahmad Abdalla, 08.06.2020Hat „die Gesellschaft der Angst“, von der der Soziologe Heinz Bude in seinem gleichnamigen Buch schreibt, mit Covid-19 nun ihre entsprechende Kulisse gefunden? Denn nichts mag bedrohlicher und unmittelbarer erscheinen als eine Pandemie: Wir können nicht wissen, ob oder wann sie aufhört. Für ihre Bekämpfung müssen Staaten Maßnahmen ergreifen, die unerwünschte Folgen haben werden. Und wie schwerwiegend diese Folgen ausfallen, kann uns noch niemand sagen.
Menschen werden derzeit also von täglichen Ängsten getrieben: der Angst, angesteckt zu werden oder andere anzustecken, der Angst um Nahestehende, Angst vor Arbeitslosigkeit, vor dem wirtschaftlichen Ruin, dem Verlust des Status, der Angst vor Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten. Werden unsere Freiheiten nach Covid-19 dieselben sein wie zuvor? Das fragen sich viele besorgt.
Ich frage mich das selber auch und hoffe auf ein „Jein“ als Antwort. Denn sicherlich vermisse ich die Kinos, die Kneipen, die Klubs und das gelassene Zusammensitzen mit Freunden in den arabischen Restaurants der Neuköllner Sonnenallee. Ich vermisse meine Uni und meine Arbeit. Bestimmt vermissen andere ganz ähnliche Dinge, wollen das Leben, so wie es war, weiterführen. Doch das heißt keinesfalls, dass dieses Leben für alle gleich gut, sicher und würdig war. Es bedeutet nicht, dass Angst im Leben aller eine ähnliche Rolle gespielt hat.
Die feministische Philosophin Sara Ahmed lehrt uns einiges über die Angst. Angst bedeutet für sie nicht bloß ein Gefühl, sie ermöglicht auch Dinge, setzt Grenzen, trennt das Innen vom Außen, organisiert das Verhältnis von Körpern zueinander und zum Raum und regelt somit menschliche Kollektive und Zugehörigkeiten immer wieder neu.
Angst, so Ahmed, kann ein Instrument zur Bildung von politischen Allianzen und der Konstruktion von Feindbildern und Drohungen sein. Zu diesen Bildern gehören die „fortschreitende Islamisierung“ oder die „Migrantenflut“. Angst dient also unter anderem als „Technologie des Regierens“, bei der nicht selten emotionale Manipulation und falsche Projektionen eingesetzt werden.[1] Spannend an unserer gegenwärtigen Angst ist jedoch, dass sie weder auf nationalen, ethnischen oder kulturellen Mythen gründet noch auf bestimmte Länder oder Gemeinschaften begrenzt ist.
Sie ist allumfassend und global. Sie trifft Demokratien und Autokratien, reich und arm, Unterdrücker und Unterdrückte. Und paradoxerweise liegen hierin neue Möglichkeiten für unser Zusammenleben. Die Vehemenz, mit der die besorgte bürgerliche Mitte in Deutschland auf ihre Freiheitsrechte in der Krise pocht, ist nachvollziehbar. Freiheit ist im Grundgesetz verankert. Sie ist ein teures, schwer erkämpftes Gut und wert, verteidigt zu werden. Doch basiert das Einfordern jener Freiheit auf Teilansichten. Denn in der Tat galt diese Freiheit niemals für alle, vielmehr wurde sie für die einen häufig auf Kosten anderer bewahrt. Die zahlreichen Einschränkungen, die gerade unerwartet die Mitte der westlichen Wohlstandsgesellschaften treffen, sind für viele Menschen trauriger Alltag – ob in Gaza oder an der türkisch-griechischen Grenze. Selbst hier, mitten in Europa, war das öffentliche Leben, das nun vermisst wird, niemals für alle gleich zugänglich. Das freie, unbeschwerte Flanieren, dem viele jetzt nachweinen, ist für einige auch vorher keine Möglichkeit gewesen.
Für sie waren nationale und soziale Grenzen schon immer unüberwindbar – für etliche Schutzsuchende aus Kriegsgebieten, für Träumer*innen aus dem globalen Süden, die im Westen nach einem gerechteren Leben suchten, für Menschen in der Diaspora. Die Ausgangssperren, die heute europäische Städte blockieren, erscheinen vielen Asylsuchenden, die nach dem Ankommen in Europa ihre Ortsgemeinde nicht verlassen durften, nicht allzu fremd. Auch das Gefühl, dass die Stadt einem nicht richtig gehört, dass man vermehrt auf sein Benehmen in der Öffentlichkeit, sein Verhältnis zu anderen achten muss, die Unsicherheit, die einen während eines Spaziergangs oder beim Einkaufen begleitet – all dies sind Dauererfahrungen, die das öffentliche Leben vieler Migrant*innen und nichtweißer Menschen prägen.
Was für einige die Krise ist, ist der Alltag der anderen. Was jedoch an der derzeitigen Krise besonders bleibt, ist, dass uns die Angst dieses Mal alle verbindet.
Heinz Bude führt die Angst moderner Gesellschaften auf einen „Optimierungswahn“ und eine „Lebenshaltung“ zurück, die „auf nichts verzichten will“[2]. Damit bringt die aktuelle Angst vor der Pandemie neue Erkenntnisse ins Spiel. Denn Verzicht gilt derzeit als Beruhigungsmittel. Damit die Welt so bleibt, wie sie war, müssen wir Verzicht auf Privilegien und Freiheiten lernen. Verzicht kann aber auch zu einer Möglichkeit werden, endlich an all diejenigen zu denken, die sonst selten mitgedacht werden und die das, worauf heute alle verzichten müssen, auch vorher nicht hatten. Eine neue Sensibilität für Verzicht macht Menschen- und Freiheitsrechte in der jetzigen Situation nicht obsolet, sondern schützt sie davor, zum „Inbegriff heuchlerischen […] Idealismus“[3] zu werden, wie Hannah Arendt einst warnte. Selbstreflexion und Verzicht sollten dazu führen, dass die Zukunft in corona-freien Zeiten anders angestrebt wird als bisher. Damit die kommende Welt gerechter und freier wird. Für alle.
[1] Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotions, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004. Siehe das Kapitel über Angst „The Affective Politics of Fear“, S. 62–82.
[2] Heinz Bude, Gesellschaft der Angst, Hamburg: Hamburger Edition, 2014, S. 96.
[3] Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München: Piper, 2001, S. 546.
+++
Dieser Essay wurde ausgewählt aus 40 weiteren Beiträgen, die uns im Rahmen unseres Wettbewerbs „Erkundungen im Maschinenraum der Demokratie“ zugesendet wurden, um sich mit den Themen Demokratie und Grundgesetz vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 2020 auseinanderzusetzen.
Drei weitere ausgewählte Essays können Sie hier nachlesen.
Der Wettbewerb entstand im Rahmen des Projekts Demokratie? Eine Frage der Verfassung! unter der Projektleitung der Soziologin Uta Rüchel in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld (Professur für Zeitgeschichte) und der Robert-Havemann-Gesellschaft. Das Projekt von WIR MACHEN DAS wird gefördert von der Bundeszentrale für Politische Bildung.