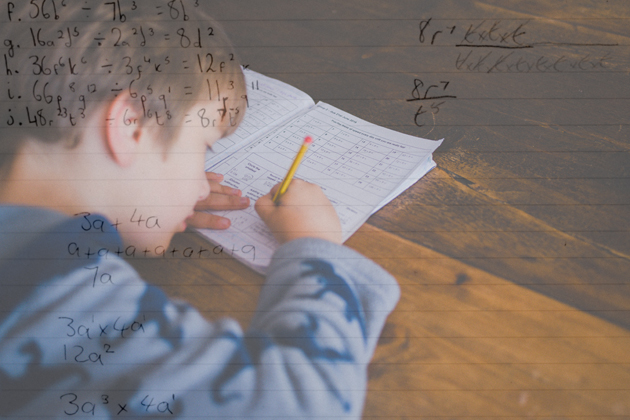Wie ein vermeintlich falscher Rechenweg zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Zugehörigkeit werden kann, berichtet Isabelle Groß. Sie schreibt über Bildungseinrichtungen und die unflexiblen Systeme, mit denen Kinder es nach der Einschulung zu tun bekommen können.
Von Isabelle Groß, 08.10.2019Grundschule, vierte Klasse, schriftliches Dividieren – in der Schule hatte alles noch irgendwie Sinn gemacht. Doch die Aufgaben zu Hause fertigzustellen, ist die eigentliche Herausforderung! Verzweifelt frage ich meine Mutter um Rat und gebe am nächsten Tag richtige Ergebnisse ab – die trotzdem falsch sind. Sie sind falsch, weil meine Lehrerin den Rechenweg nicht nachvollziehen kann. Alles grundfalsch, denn so hatte sie es uns in der letzten Mathestunde nicht beigebracht. Es ist eine meiner ersten Erinnerungen an das vermeintliche Anderssein – an das „So-geht-das-Nicht“, vielleicht sogar auch an Frustrationsgefühle gegenüber meiner Mutter. Doch den Kontext dieser Frustrationen verstehe ich erst viel später.
Es ist ein Luxus, seine Eltern um Hilfe bei den Hausaufgaben bitten zu können. Aber wenn Lehrmaterial und Unterricht anders strukturiert sind als in den Herkunftsländern der Eltern, kann das zu Verunsicherungen führen. Meine Mutter kam von den Philippinen nach Deutschland, um ihr Medizinstudium abzuschließen, meist war die Hilfe bei Grundschulhausaufgaben also kein Problem. Anfang der 1990er hatte sie meinen Vater kennengelernt, eins führte zum anderen, und heute blicke ich auf eine Kindheit in einer fünfköpfigen Familie in Baden-Württemberg zurück. Meinen Geschwistern und mir ist damals kaum aufgefallen, dass wir nicht „ganz so deutsch“ waren wie die anderen.
Bemerkt habe ich es immer nur dann, wenn andere mich darauf hinwiesen. Wenn deutlich wurde, dass ich etwas nicht „richtig“ mache. Wenn ich Dinge tat, die „man so nicht macht“, wenn Erwartungshaltungen über den Haufen geschmissen wurden, weil ich nicht wusste, dass nur diese eine Version des Handelns „zugelassen“ war. Meistens ergaben sich daraus keine größeren Probleme, doch, wie Erfahrungen in der Kindheit es so an sich haben, ist mir gerade diese erste Erinnerung, der Frust über verpatzte Hausaufgaben, im Gedächtnis geblieben.
Die Aufgaben wurden am nächsten Tag besprochen, und meine Lehrerin war von der Methode, die ich angewandt hatte, verwirrt. Sie sah sich mein Arbeitsheft genauer an und meinte, dass ich die gesamten Hausaufgaben falsch gemacht hätte. Was ich vorzuweisen hatte, zählte nicht, egal, wie viel Energie und Mühe wir am Vortag reingesteckt hatten.
Es ist natürlich so, dass in der Grundschule bestimmte Grundkenntnisse vermittelt werden sollen. Dabei ist auch eine gewisse Einheitlichkeit nachvollziehbar, aber faire Bildung wird eben nicht unbedingt durch Konformität vermittelt. Viele pädagogische Methoden berücksichtigen deshalb bereits die unterschiedlichen Hintergründe und Persönlichkeiten von Kindern. Gerade im Falle von kulturellen Unterschieden jedoch sind Lehrer*innen häufig noch etwas blind auf beiden Augen. Vielleicht klingt es überspitzt, dramatisch gar, dass mir die Reaktion der Lehrerin so vehement in Erinnerung blieb. Ihr rigoroses Urteil: Was ich getan hatte, war „falsch“ – obwohl mir der Rechenweg meiner Mutter viel sinnvoller erschien.
Heute müsste ich zwei Mal überlegen, bevor ich eine schriftliche Division lösen könnte. Wie kann es also sein, dass ich mir noch immer Gedanken über dieses kleine Schulmissverständnis mache? Vielleicht, weil sich in diesem Moment meine Wahrnehmung von Richtig und Falsch formte, weil ich mich selbst aus Perspektive „der anderen“ wahrnahm. Für mein achtjähriges Ich war die Ablehnung, die ich trotz eines richtigen Ergebnisses und eines sinnvollen Rechenwegs erntete, unverständlich. Meine Mutter hatte mir doch geholfen, sie wusste, wovon sie redet, sicherlich doch!
Es war einfach nicht der geeignete Moment, um zu lernen, dass meine Eltern fehlbar waren. Denn für mich bedeutete es in diesem Kontext nur, dass meine Mutter „falsch“ lag. Dass sie mir nicht dabei helfen konnte, die Kategorisierungen von „richtig“ und „falsch“ zu verstehen. Nicht, weil sie nicht dazu in der Lage war, sondern aus dem schlichten Grund, dass die Lehrerin es behauptete – weil die Schule, diese Bildungsinstitution, es so einstufte. Vielleicht war es auch die Konkurrenz zwischen Autoritätspersonen, die im Leben eines Kindes ja ganz normal ist. Doch der Migrationshintergrund meiner Mutter verrückte das Problem in andere Kontexte und kreierte eine ungeahnte Zwickmühle für mich.
Ich erinnere mich ähnlich lebhaft daran, mit welcher Vehemenz ich nach der Mathestunde die Hilfe meiner Mutter ablehnte. Dass nicht nur die Schule, sondern auch viele andere Kontexte, wie Essen, Freizeitbeschäftigungen oder Freund*innen finden, eigene Kategorisierungen von „richtig“ und „falsch“ bekamen, die mich immer wieder vor den Kopf stießen. Als Kind versucht man in bestimmten Phasen, sich anzupassen und nicht zu sehr aufzufallen, da gibt man der Mehrheit schnell nach. Alleine vor Mitschüler*innen und Lehrpersonal eine Divisionsmethode zu verteidigen, war mir damals nicht möglich – es war auch gar nicht nötig. Doch ich hätte es gerne gekonnt.
Gerade weil ich den Grad an Verletztheit, den meine Mutter womöglich in dieser Zeit empfand, erst heute erahne. Sie tat immer ihr Bestes und war an unserer Seite, und es tut mir leid, dass ich im Widerstand gegen manche Wahrnehmungen von „richtig“ und „falsch“, die mich in meiner Kindheit verunsicherten, nicht immer zu ihr stehen konnte.
Vielleicht möchte ich Lehrer*innen heute einfach dazu anregen, ihren methodischen Horizont zu erweitern. Falls möglich, sich die Zeit zu nehmen und klarzustellen, dass das „Vorbeidenken“ an manchen Standards nicht automatisch falsch ist – oder sogar „schlecht“, sondern einfach nur anders. Dass „anders“ auch gut sein kann, dass Unterschiede zelebriert werden können und dass „falsch“ und „richtig“ in vielen Schattierungen daherkommen. Mir erscheint das heute als selbstverständlich – ich wünschte, ich hätte damals schon die Kraft gehabt, es so zu sehen.