Für diesen Text hat Farah Barqawi drei Stunden lang mit ihrer Mutter, Zeynab Alghunaimi, geredet. Über das gemeinsame Leben zwischen Libanon, Syrien, Palästina und Deutschland und vieles, was sie sich über die Distanz lange nicht sagen konnten.
Von Farah Barqawi, 08.10.2021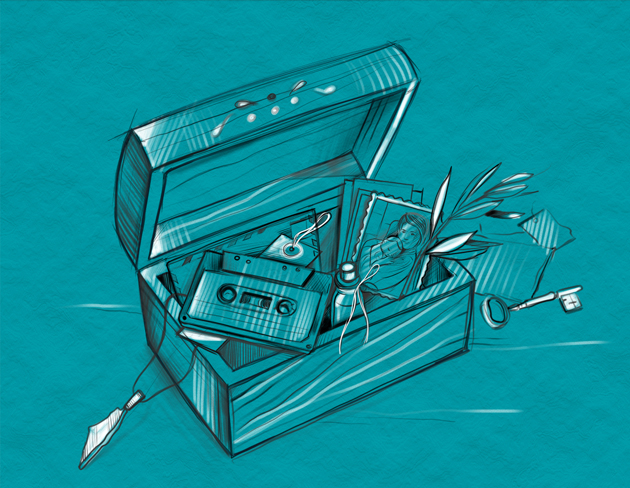
Illustration: Alia Abou Khaddour
Vor einigen Monaten bekam ich die Einladung, einen Text über Palästinenser*innen in Syrien zu schreiben. Seitdem grübele ich und lasse Bilder und Erinnerungen aus meinem Leben in Syrien Revue passieren.
Bis zu diesem Auftrag war meine Beziehung zu Syrien gelegentlich in den Hintergrund gerückt, manchmal hatte ich sie sogar bewusst verdrängt. Dabei ist sie in meine Haut eingebrannt, in meine Sprache, sie steckt in der Art und Weise, wie ich mich präsentiere. Doch wie sollte ich mich diesem Ort nähern, wie unsere Geschichte reparieren? Ich muss gestehen, dass ich noch nicht mal sicher bin, ob meine Worte an dieser Stelle überhaupt legitim sind.
Es stellte sich heraus, dass meine Mutter der Schlüssel war. Die räumliche und zeitliche Entfernung zwischen uns wird Jahr für Jahr größer. Mit einem Gespräch wollte ich mich wieder an sie herantasten. An unsere gemeinsame Geschichte und an die, die wir getrennt voneinander erlebt haben. Als Studentin lebte sie in Kairo, danach in Beirut, und mit neunundzwanzig Jahren zog sie nach Syrien, wo ich geboren wurde. 1995 verließen wir zusammen das Land und gingen zurück nach Gaza – sie war zweiundvierzig.
Dieser Text ist das Ergebnis eines dreistündigen Zoom-Gesprächs. Es begann um 16:00 Uhr Berliner Zeit und endete um 20:00 Gaza-Zeit.
Station Nr. 1: Ankommen
Meine Mutter wurde 1953 in Rafah in eine Familie geboren, die 1948 aus Tel Aviv-Jaffa vertrieben worden war. Sie wuchs in Gaza auf und studierte Jura in Kairo. Als sie 1977 ihr Studium abschloss, durfte sie nicht mehr nach Gaza zurück, da sie einmal von der israelischen Besatzung verhaftet worden war. Sie durfte auch nicht in Ägypten bleiben, weil palästinensische Student*innen unter Anwar as-Sadat verfolgt wurden, vor allem zur Zeit der Camp-David-Verhandlungen. Beirut war in jeder Hinsicht die einzig logische Konsequenz. Dort wurde meine Mutter politisch aktiv und begann für den Pressedienst der PLO zu arbeiten – für die Zeitung Filastin Athawra und für Wafa, die Nachrichtenagentur der palästinensischen Autonomiebehörde Dort lernte sie meinen Vater kennen.
Nach der israelischen Invasion 1982 in Beirut änderte sich die Lage für den palästinensischen Widerstand grundlegend. Mit dem Waffenstillstandsabkommen begann eine unfreiwillige Auswanderungswelle. Jeder und jede, die nicht im Besitz eines palästinensischen Reisedokuments des libanesischen Staates war, musste das Land verlassen. Dies betraf alle Palästinenser*innen, die Reisedokumente aus anderen arabischen Staaten oder Flüchtlingsreisedokumente besaßen. Also auch meine Mutter, die ein in Ägypten ausgestelltes Dokument für palästinensische Flüchtlinge hatte. Der Abzug fand etappenweise statt und führte in verschiedene Länder. Auf einmal waren Aktivist*innen der palästinensischen Revolution in verschiedenen Häfen des Mittelmeers und darüber hinaus gestrandet.
- Zeynab: Wir verließen Beirut in verschiedene Richtungen. Manche gingen in den Jemen oder nach Algerien, vor allem Kämpfer*innen und ihre Familien. Andere gingen nach Tunesien, begleiteten Abu Ammar (Yassir Arafat) und die palästinensische Führung, die andernorts nicht willkommen waren. Manche gingen nach Zypern. Dein Vater und ich entschieden uns für Syrien.
- Farah: Warum?
- Zeynab: Wir wollten nicht nach Tunesien, weil es dort keine palästinensische Gemeinde oder ein Flüchtlingscamp gab. Wir hatten das Gefühl, dass Tunesien zu weit weg war, und wir wollten nicht so weit entfernt von unserem Herkunftsland leben, wo unsere Wurzeln lagen. Da ist eine Wärme, die man in den Anrainerstaaten von Palästina spürt – in Ägypten, Jordanien, Syrien, auch im Libanon. Dort gab es eine revolutionäre Stimmung, einen spürbaren Bezug zu Palästina. Als der palästinensische Widerstand Jordanien und dann den Libanon verlassen musste, war Syrien das einzige Land, in dem wir uns als Mitglieder der Kommunistischen Arbeiterpartei niederlassen konnten. Wir fanden immer, dass es wichtig sei, mit unserem Volk zusammen zu leben.
Meine Mutter wird emotional, während sie die Wahl zwischen Tunesien und Syrien bewertet. Sie kann nicht nachvollziehen, warum manche Palästinenser*innen ins weit abgelegene Tunesien gingen. Aber sie sagt auch, dass das syrische Regime den palästinensischen Widerstand nicht gerade willkommen hieß. Sie ärgert sich über die Form des Waffenstillstandsabkommens, das die Beiruter Palästinenser*innen zerstreut hat. Sie nennt es das „Schande-Abkommen“, beschreibt die damals öffentlich propagierte Haltung des syrischen Regimes gegenüber dem palästinensischen Widerstand und den Palästinenser*innen als problematisch.
- Farah: Was du sagst, ist widersprüchlich. Du sagst, dass Syrien nicht der richtige Ort war und dass ihr nicht willkommen gewesen seid, aber auf der anderen Seite hieltet ihr es doch für den besten Ort …
- Zeynab: Ja, warum sind wir nach Syrien gegangen? Ich glaube, wir hatten einfach wirklich keine andere Wahl. Wohin hätten wir sonst gehen sollen? Was hätten wir tun sollen? In Syrien lebten wenigstens Palästinenser*innen.
Ich lache über die Formulierung meiner Mutter. Syrien, ja und nein, Syrien, gewählt, aber auch erzwungen.
- Zeynab: Wir waren eine politische Partei. Als Kommunistische Arbeiterpartei wollten wir politische, kulturelle und aufklärerische Veranstaltungen für die Menschen und mit den Menschen machen. Die syrische Regierung behauptete damals, sie würde die palästinensische Sache verteidigen, und es gab palästinensische Organisationen, die damit konform gingen. Nach dem Ende des Libanon-Feldzugs 1982 bestand weitgehend Harmonie zwischen den linken palästinensischen Organisationen und dem syrischen Regime. Die einzigen, die verfolgt wurden und denen untersagt wurde, in Syrien politisch tätig zu sein, war die Fatah-Bewegung unter der Führung von Abu Ammar.
- Farah: Das heißt, ihr habt geträumt oder gehofft, dass die Dinge besser würden?
- Zeynab: Nein, das haben wir nicht, überhaupt nicht. Wir waren trotz der angeblichen Sympathien Syriens sehr vorsichtig, vor allem, weil wir dort nicht offiziell zugelassen waren – wir waren von Anfang an nicht als politische Partei anerkannt. Wir waren kein Teil der palästinensischen Organisationsstruktur der PLO, mit der Syrien damals zusammenarbeitete. Wir waren eine kommunistische Partei und arbeiteten mit syrischen kommunistischen Gruppen zusammen, vor allem mit der Organisation der kommunistischen Arbeit. Und die war auch nicht zugelassen.
Vorsichtig sein hieß, nicht offen politisch tätig zu sein, sich als „gute Bürgerin“ unauffällig zu verhalten. Nachdem die Partei Anfang der neunziger Jahre aufgelöst wurde, verstreuten sich ihre Mitglieder in alle Welt, wie die übrigen Kader des palästinensischen Widerstandes, und arbeiteten in ihren alten Berufen weiter. Nach kurzer Zeit war es nicht mehr möglich, politisch im Untergrund zu arbeiten. Meine Mutter blieb und mein Vater ging zurück nach Palästina. Die Entfernung, äußere Umstände und persönliche Differenzen führten schließlich zu ihrer Trennung, die noch vor meiner Geburt stattfand.
*******
Station Nr. 2: Wie baut man auf Wanderdünen ein Nest?
Der Umzug aus dem Libanon nach Syrien veränderte viel oder, wie meine Mutter es beschreibt: „Beziehungen zerbrachen und damit die revolutionäre Seele, die wir im Libanon hatten.“ Liebe und Kameradschaft gingen verloren, obwohl die politische Arbeit in der einen oder anderen Form fortgesetzt wurde. Alle hatten das Gefühl, dass etwas fehlte.
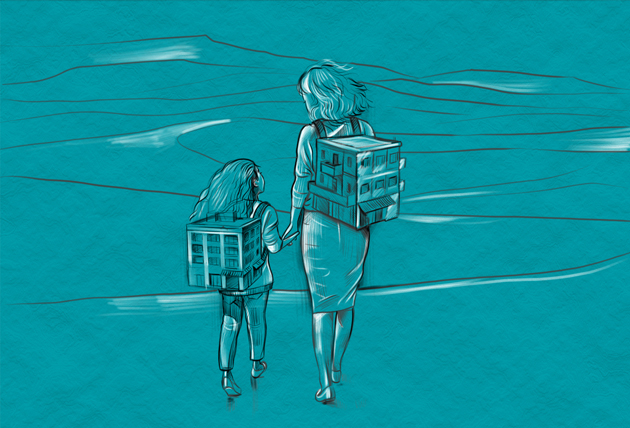
Einige der aus dem Libanon Vertriebenen waren geflüchtete Menschen aus Syrien. Sie fügten sich relativ leicht wieder in ihre Gesellschaft ein. Andere waren mit ihren syrischen Familien aus dem Libanon zurückgekommen, wo sie Verwandte und Parteifreunde hatten. Auch sie hatten es leichter. Für Familien, die erst im Libanon gegründet worden waren, war es dagegen schwerer. Manche gingen auseinander, manche klebten aneinander und manche versuchten es mit halbherzigen Lösungen.
Fast alle palästinensischen Parteien zogen nach Syrien und mit ihnen auch ihre innerparteilichen Konflikte. Vielleicht wurden die Probleme unterwegs sogar größer. Das führte dazu, dass noch mehr Zersplitterung und Konflikte entstanden.
Zeynab: Du darfst nicht vergessen: Nicht alle Genoss*innen waren Freunde. Konkurrenzdenken innerhalb der einzelnen Organisationen war weit verbreitet.
Meine Mutter tanzte häufig aus der Reihe, schon weil sie einer Partei angehörte, die aus der Reihe tanzte. Sie war nicht in einer traditionellen Familie aufgewachsen und war es gewöhnt, ihre Stimme immer laut zu erheben. Auch ihre Ausweisdokumente waren unübersichtlich: Sie hatte ein abgelaufenes Dokument für Flüchtlinge von der ägyptischen Regierung und einen jemenitischen Pass, den damals viele der palästinensischen Aktivist*innen besaßen. Nur wenige Mitglieder des palästinensischen Widerstands besaßen solche Dokumente. Die Strategie meiner Mutter, um mit der fehlenden Verortung umzugehen, war folgende: „Wenn du hier lebst, musst du dafür sorgen, dass du dich in dir selbst integrierst. Auch wenn niemand dich als Bürgerin akzeptiert, weil du nicht die passenden Dokumente besitzt.“ Ich denke über diesen Satz nach, während ich ihn aufschreibe, und ich glaube, dass ich dieses Denken von ihr übernommen habe.
Meine Mutter setzte ihre Arbeit als Vorstandsmitglied der palästinensischen Frauenunion fort, der sie als Unabhängige angehörte. „Ich war Zeynab und nicht die Vertreterin einer Partei.“ Die Arbeit als Journalistin und die Tätigkeit beim Schriftsteller*innenverband eröffneten ihr Möglichkeiten in der Kultur- und Kunstszene Syriens, später knüpfte sie darüber Kontakte in Bahrein, Jemen und im Irak. Sie war nicht abhängig vom palästinensischen Umfeld oder der Gemeinschaft geflüchteter Palästinenser*innen. Sie bemühte sich, den politischen Spaltungen fern zu bleiben, unter denen die PLO nach 1982 litt, und ihr Engagement für die Sache der Frauen sowie ihre Arbeit als Journalistin und beim Schriftsteller*innenverband davon abzuschirmen. Diese Unabhängigkeit gab ihr die Möglichkeit, zwei Existenzen mit gelegentlichen Berührungspunkten zu pflegen. Ich bin 1985 zwischen diesen beiden Lebenswelten entstanden.
Zuerst wohnten wir im Damaszener Viertel Rukn El-Din, das viele palästinensische Kämpfer*innen aufgenommen hatte. Danach lebten wir mehr als elf Jahre im Flüchtlingslager Jarmouk.
Ich kannte das Leben im Lager wie außerhalb, zwischen den UNRWA[1]-Schulen der Vereinten Nationen und dem Klavierunterricht im russischen Kulturzentrum, zwischen der Arraschid-Bibliothek und dem Alhassan-Blumenladen, zwischen dem Hähnchengrill in der Al-Mansoura-Straße und dem Arbeiterclub, Abu Kamal und der Goldlaterne in Alsalhia. Ich lebte zwischen kulturellen Aktivitäten im Zentrum von Alkhalsa und Eröffnungen von Kunstaustellungen und Büchermessen.
In sämtlichen Kultureinrichtungen sammelten wir Werbeartikel und Souvenirs, immer mit dem leisen Gefühl, als würden wir sie zum letzten Mal besuchen. Wir versahen sie mit Namen und Datum. Merkwürdig und schön, dass wir all diese Erinnerungsstücke später mitnahmen. Die schönen und die weniger schönen. Wir packten sie in Kisten und legten sie zu unserem Gepäck, das wir in freudlose Länder mitnahmen, die uns keinen Anlass für weitere Erinnerungen gaben.
– Zeynab: Unsere Wohnung war ein Kulturtreffpunkt. Vielleicht auch, weil wir keine große Familie waren und keine verzogenen Kinder hatten. Du warst ein sehr ruhiges Kind, hast keine Probleme gemacht, was mir viel Lebensenergie ließ. Das Leben im palästinensischen Flüchtlingslager und außerhalb mit den Syrer*innen empfand ich als angenehme stabil. Syrien war für mich zu der Zeit ein Zuhause, es war mein Land. Vielleicht half es, dass ich vorsichtig war und Schwierigkeiten mit dem System vermied.
Zu jener Zeit waren wir überall. Hier und dort. In allen Himmelsrichtungen. Wir waren sesshaft zwischen Wanderdünen.
Station Nr. 3: Wir waren Gäste. Aber waren wir syrische Palästinenserinnen?
- Farah: Mama, wir sprechen immer über die Osloer Niederlage. Aber nach dem, was du hier erzählst und was später geschah, begann die Niederlage bereits 1982.
- Zeynab: Ja, natürlich, das stimmt, es begann 1982 mit der militärischen Niederlage der PLO.
- Farah: Aber es bleibt die Zeit vor den Madrider Verhandlungen und dem Osloer Abkommen. Wie hast du dir die Zukunft damals vorgestellt? Hast du gedacht, dass dein Aufenthalt nur vorübergehend ist, oder dachtest du daran, in Syrien zu bleiben? Du hattest ja soziale Kontakte und ein einigermaßen stabiles Leben.
- Zeynab: Ich hatte das Gefühl, dass die palästinensische Sache eines Tages obsiegen und die israelische Besatzung vertrieben würde. Ich war überzeugt, dass wir Lösungen für den Konflikt finden und nach Palästina zurückkehren würden.
- Farah: Aber war das nicht der Traum von allen, einschließlich der Flüchtlinge?
- Zeynab: Ja, natürlich, das ist der Traum aller Flüchtlinge seit 1948. Aber sie unterschieden sich und manche Träume begannen zu schwinden. Manche Palästinenser*innen lebten schon lange in der Diaspora und waren in der syrischen Gesellschaft weitgehend integriert. Die älteren Generationen starben bereits, neue wurden geboren. Und Syrien war im Laufe der Zeit für sie zur Heimat geworden.
Menschen wandern freiwillig, gezwungen oder aus der Not heraus aus. Sie wandern aus oder sie werden vertrieben. Sie gehen ins Ausland zum Studieren oder zum Arbeiten. Manche sind privilegiert, andere weniger. Geschlecht, Hautfarbe, Ethnie, wirtschaftlicher Status, sozialer Stand, Herkunftsland und die politische Bedeutung eines Reisepasses spielen dabei eine entscheidende Rolle. Was den Palästinenser*innen bei ihrer ständigen Vertreibung widerfuhr, ließ neue soziale Schichten mit bestimmten Privilegien entstehen. Und die waren immer von den politischen Faktoren des aktuellen Aufenthaltsortes abhängig. Es zählte, zu welcher Zeit und wohin sie vertrieben wurden und welche Papiere man im jeweiligen Land bekam, ob es gefälschte oder originale waren, ob man in der geduldeten politischen Arbeit oder im Untergrund tätig war. Immer wieder neue Rahmenbedingungen und persönliche Entscheidungen haben das Leben und die Narrative der Palästinenser*innen bestimmt.
– Farah: Vor 1982 waren die meisten Palästinenser*innen in Syrien Flüchtlinge. Du aber warst kein syrisch-palästinensischer Flüchtling, wie es außerhalb von Syrien hieß. Die palästinensischen Flüchtlinge, die sich 1948 und in den darauffolgenden Jahren in Syrien niederließen, hatten mehr Rechte als jene, die später aus dem Libanon oder Ägypten nach Syrien kamen. Sie hatten Recht auf Arbeit, kostenlose Schulbildung, Studium und sie hatten sogar Chancen, im öffentlichen Dienst zu arbeiten.
– Zeynab: Denjenigen, die andere Reisedokumente hatten – aus Ägypten, dem Jemen oder Jordanien –, erging es anders. Sie waren in Syrien Ausländer*innen, selbst wenn sie den Dokumenten nach Jemenit*innen, Ägypter*innen oder Jordanier*innen waren, die im Flüchtlingslager lebten. Es war nicht einfach für uns, in den öffentlichen Dienst zu kommen oder in den Genuss einer kostenlosen Schulbildung, aber es gab in Syrien mehr Möglichkeiten für ein Leben in Freiheit und für Kontakt mit der Außenwelt.
- Farah: Mama, weißt du, als ich gebeten wurde, diesen Text zu schreiben, habe ich über die Bezeichnung palästinensische Syrerin nachgedacht und hatte das Gefühl …
- Zeynab: … dass sie nicht zu dir passt.
- Farah: Genau.
- Zeynab: Das gilt auch für mich. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Wir haben nämlich nicht dieselben Rechte und die Lebensbedingungen, die andere Palästinenser*innen in Syrien haben. Sie haben Arbeit, dürfen Besitz erwerben, Häuser bauen und kostenlos an der Universität studieren. Ich dagegen durfte mich nicht einschreiben, um mein Masterstudium abzuschließen, das ich an der libanesischen Universität begonnen hatte. Ich hätte dafür ein außerordentliches Dekret gebraucht.
- Farah: Und wie war es mit Schulen? Ich war ja an einer UNRWA-Schule.
- Zeynab: Als der Krieg 1982 ausbrach, gab es in Syrien den Beschluss, dass alle Palästinenser*innen, die aus dem Libanon kamen, bis zum Abitur an syrischen Schulen angemeldet werden dürften.
- Farah: Wenn du nicht mit den Flüchtlingskarawanen nach Syrien gekommen wärst, hättest du das Land mit deinen Papieren wahrscheinlich nicht betreten dürfen, oder?
- Zeynab: Ja, das ist so. Ohne dieses Abkommen hätte ich mit Sicherheit nicht nach Syrien gehen können. Vielleicht hätte ich das Land nie im Leben betreten. Ich saß im Libanon mit ägyptischen Reisedokumenten. Als ich 1980 vom Flughafen Damaskus nach Kopenhagen flog, um in Dänemark an einem Frauenkongress teilzunehmen, musste dies von der PLO-Vertretung koordiniert werden, damit ich den Flughafen überhaupt betreten durfte. Später half mir der südjemenitische Pass, den ich besaß. Und als der Jemen wiedervereinigt wurde, bekam ich ein Reisedokument, das ich bis Anfang der neunziger Jahre behielt. Noch später, als die jordanische Regierung die Mitgliedschaft in einer palästinensischen Organisation nicht mehr unter Strafe stellte, bekam ich den jordanischen Reisepass. Ab dem Moment durfte ich legal als Journalistin in einer Einrichtung arbeiten, die nicht zur PLO gehörte.
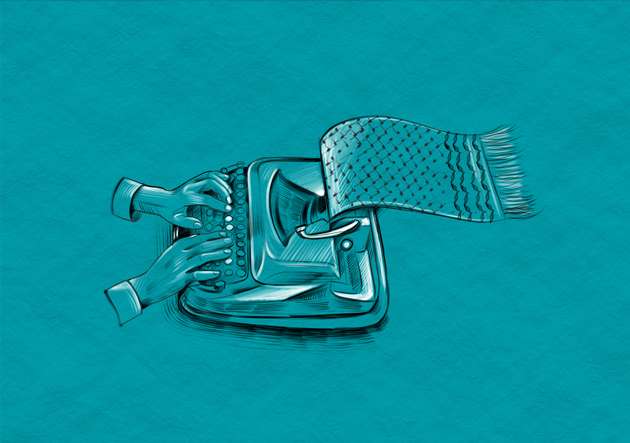
Die Gruppe der linken Revolutionäre, die 1982 aus dem Libanon nach Syrien vertrieben wurden, war ziemlich heterogen. Umstände und Möglichkeiten der einzelnen Personen waren völlig unterschiedlich, schon weil sie unterschiedliche Dokumente besaßen. Das einzig Verbindende war die Unsicherheit ihrer Situation. Sie fanden ihren Platz in der Gesellschaft zwischen Syrer*innen und palästinensischen Flüchtlingen nur schwer, waren aber auch nicht gänzlich ausgegrenzt. Für die Neuankömmlinge fühlte es sich wie ein langer Besuch an. Das ist ein Teil der palästinensischen Tragödie.
- Zeynab: Wir haben uns nicht als syrische Palästinenser*innen gefühlt und niemand hat uns so behandelt. Sie haben uns behandelt, als wären wir ihre Gäste. Sie blickten anders auf uns.
- Farah: Wie denn?
- Zeynab: Leider haben einige Genossen*innen mit Überheblichkeit auf die anderen geblickt. Das war schon im Libanon so. Sie dachten, sie seien die Revolutionäre, die die Flagge der Revolution, der Befreiung und des Kampfes hissten.
- Farah: Hast du das Gefühl, dass du auch ein Teil dieses Milieus warst?
- Zeynab: Man konnte Teil dieses Systems werden, ohne es zu wollen, auch wenn man gute Absichten hatte. Wir bildeten uns ein, dass wir die politische Weisheit mit Löffeln gefressen und die Lasten des Kampfes geschultert hatten, dass wir diejenigen waren, die die anderen darüber aufklärten, was Heimat bedeutet.
- Farah: Also revolutionäre Arroganz …?
- Zeynab: Wenn man so denkt, wird man irgendwann Teil der Misere, trägt zur Spaltung der Gesellschaft bei und vertieft die Gräben.
- Farah: Ok, aber was war mit der Gesellschaft im Flüchtlingslager und mit den geflüchteten Menschen? Wie haben sie euch behandelt?
- Zeynab: Einige haben uns akzeptiert, mal aus Mitleid, mal aus Liebe zur Revolution oder weil sie sich neue Möglichkeiten oder eine Arbeit erhofften. Wir hatten als Revolutionär*innen ja einen sozialen Status, der hoch angesehen war. Auf uns wurde die Hoffnung projiziert, dass die Rückkehr in die Heimat unmittelbar bevorstand. Auch deshalb unterstützte man uns. Und einige haben ihren Traum von der Rückkehr tatsächlich verwirklicht. Die Osloer Verträge ermöglichten es denjenigen, die jemanden aus Palästina geheiratet hatten oder auf den Listen der verschiedenen Organisationen standen, zurückzukehren.
Meine Mutter glaubt, dass Fremdheitsgefühle, aber auch Zugehörigkeitsgefühle bei uns deutlicher ausgeprägt waren als bei anderen Familien. Sie führt es darauf zurück, dass sie als Frau im Camp unabhängig, gebildet und aktiv war. Im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die weniger Glück hatten, die nicht in die Schule gegangen waren, nicht studiert hatten, nicht arbeiteten und nicht unabhängig waren, war meine Mutter relativ autonom. Sie nahm den anderen dabei nichts weg und stellte keine Konkurrenz für sie dar. Und das führte dazu, dass sie von ihnen akzeptiert und freundlich aufgenommen wurde.
Station Nr. 4: Solidarität und Ersatzfamilien
Am 3. Oktober 1992 war ich sieben Jahre alt. Wir überquerten die Al-Mansoura-Straße im Flüchtlingslager und gingen zum Haus gegenüber. Meine Mutter zog sich an diesem Tag nicht wie gewöhnlich ihren Lidstrich und trug auch keinen Lippenstift. Auch auf ihre bunten Ohrringe verzichtete sie. Ich erinnere mich gut daran. Ich fragte sie nach dem Grund und sie antwortete, dass ihre Mutter, meine Großmutter, Um Fauwzi, am Tag zuvor verstorben sei. Diesem knappen Satz fügte sie nichts weiter hinzu. Ich wusste damals nicht, was der Tod war, und auch nicht, wer meine Großmutter war, aber ich tröstete sie: „Sei nicht traurig, meine Liebe. Alle Mütter sterben irgendwann.“
Wir erreichten den Eingang des Hauses von „Tante“ Um Hussam, deren Töchter ich gut kannte. Sie öffnete uns die Tür und war erstaunt über das Aussehen meiner Mutter. Beharrlich fragte sie, was mit ihr los sei. Sie wiederholte die Frage, die ich ihr zwei Minuten zuvor gestellt hatte. Und meine Mutter wiederholte ihre knappe Antwort. Um Hussam umarmte sie und schluchzte. Sie drückte sie an ihre Brust. Meine ansonsten immer starke Mutter begann auch zu weinen. Sie hatte meine Großmutter das letzte Mal vor etwa zwölf Jahren gesehen.
******
Um Hussam wohnte schon immer in diesem Haus, nur die enge Straße trennte uns. Als meine Mutter ins Flüchtlingslager kam, war sie so gut wie alleine. Sie war die Erste, die in unser Gebäude einzog, bevor die übrigen Wohnungen vergeben wurden. Der Altersunterschied zwischen ihr und Um Hussam betrug nur ein Jahr, aber Um Hussam hatte viele Kinder. Die beiden verband eine innige Freundschaft und ein Vertrauen, das meine Mutter brauchte. Außerhalb führte sie ihr politisches und kulturelles Leben, aber in unserer Beziehung zu Um Hussam und ihrem Haus spiegelte sich unser Leben in Jarmouk mit all seinen Widersprüchen und Gefahren.
Ihr Haus wurde auch mein Zuhause. Schon als Säugling betreute sie mich, während meine Mutter an Sitzungen und langen Konferenzen teilnahm. Ich hatte Glück, denn nur vier Monate vor meiner Geburt wurde Um Hussams sechste Tochter, Amani, geboren. Mit ihr zusammen hat sie mich damals gestillt. Sie und ihr Mann Abu Hussam waren wie Eltern für mich.
*****
In Gaza gab es einen Stromausfall. Die Unterhaltung mit meiner Mutter wurde unterbrochen. Als sie sich zurückmeldet, sagt sie: „Einen Augenblick, ich muss umschalten …“
– Zeynab: Erinnerst du dich an den Schalter, mit dem wir bei Stromausfall im Camp immer auf eine zweite Leitung umgeschaltet haben, obwohl es verboten war?
– Farah: Ja, ich erinnere mich. Es gab diesen Stromschalter zwischen unserer Wohnung und der von Um Hussam. Sie hatte eine andere Leitung. Wie oft hörte man im Lager den Satz: „Der Strom ist wieder da“? Man hörte man ihn häufiger als „Guten Morgen“. Als ich früher in Gaza lebte, war die Situation nicht so miserabel. Alles dort schien so neu, fast glitzernd, zivilisiert, ganz anders als in Damaskus, das von der Außenwelt abgeschottet war. Aber in den letzten Jahren scheint auch Gaza in eine andere Epoche zurückgefallen zu sein. Stromumschalter sind Teil meines Lebens geworden.
Ich frage meine Mutter nach ihrem Verhältnis zu Um Hussam. Sie waren so herzlich miteinander, trotz der gravierenden kulturellen und sozialen Unterschiede. Ich will wissen, ob es echt war oder ob sie eine Maske aufgesetzt hat.
Zeynab: Um Hussam hat eine spontane Natur, sie liebt es, Menschen und Nachbar*innen kennenzulernen. Ehrlich gesagt hat sie in unserer Freundschaft den ersten Schritt gemacht. Ich schließe nicht so leicht Freundschaften, überwinde soziale Distanzen nicht einfach so. Deswegen bin ich ihr dankbar für ihre Initiative. Sie hat mir beigebracht, wie ich Barrieren überwinden kann. Das war auch wichtig für mein Leben in der syrischen Gesellschaft.
- Farah: Wie meinst du das?
- Zeynab: Um Hussam war diejenige, die soziale Barrieren überwand und mir gezeigt hat, wie man es macht – wie man Beziehungen und Freundschaften zu Menschen gestaltet und pflegt. Sie hat mir gezeigt, dass man Menschen nicht nach rechts und links aussortiert, weil man dann am Ende alleine dasteht. Dank ihr habe ich Freund*innen außerhalb des politischen Milieus gefunden, die mein Leben und auch deins bereichert haben.
Um Hussam und später auch Um Wissam, unsere Nachbarin auf derselben Etage, waren im Flüchtlingslager die wichtigsten Stützen für meine Mutter. Sie kannte sie sehr gut und vertraute ihnen. Sie halfen ihr, ihrer politischen und kulturellen Arbeit nachzugehen und sogar Versammlungen in unserer Wohnung abzuhalten, ohne dass die Nachbar*innen lästerten. Vor allem, weil meine Mutter alleinerziehend war und keine Familie vor Ort hatte.
- Zeynab: Ich war ganz ehrlich zu Um Hussam. Sie wusste, dass ich Politikerin in einer Partei war, als Journalistin arbeitete und über ein Netz von Kontakten verfügte. Wenn ich zu Besuch kam, half sie mir manchmal das Essen für unsere Treffen vorzubereiten.
- Farah: War es für dich nicht befremdlich, als sie anfing, mich zu stillen?
- Zeynab: Überhaupt nicht. Das war absolut logisch. Sie war für mich wie eine Schwester.
Auch May war für meine Mutter wie eine Schwester. Sie war jünger und lebte ab 1984 mit ihr zusammen. Sie erlebte meine Geburt und prägte meine Persönlichkeit mit. Sie blieb bei meiner Mutter, bis ihr Lebenspartner aus dem Gefängnis entlassen wurde, mit dem sie dann im Flüchtlingslager zusammenzog. Etwas später gingen May und ihr Mann nach Jordanien. All diese Solidarität, Geschwisterlichkeit und Wärme trugen maßgeblich dazu bei, dass unser Leben trotz der Fremde erträglich, eigentlich auch schön war.
Station Nr. 5: Heimkehr. Aber wohin?
In den letzten zwei Jahren im Flüchtlingscamp waren wir infolge der Veränderungen, nach dem Einfrieren von PLO-Geldern und der Einstellung der Pressearbeit, gezwungen, alternative Einnahmequellen zu suchen. Meine Mutter kratzte alles zusammen, was sie hatte, und eröffnete ein Schreibwarengeschäft in der Straße, in der unsere Wohnung lag. Sie bot Schreibmaschinenkurse an, weil es damals noch keine Computer gab. Da wir im Flüchtlingslager lebten, war eine Lizenz für das Geschäft nicht erforderlich. Die finanziellen und politischen Sorgen quälten meine Mutter unentwegt. Und irgendwann, als sich die Gelegenheit bot, traf sie die Entscheidung, nach Gaza zurückzukehren.
- Farah: Ich habe mich oft gefragt, ob wir wirklich zurückkehren mussten und wie es heute wäre, wenn wir nicht zurückgegangen wären.
- Zeynab: Vielleicht hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, wenn ich eine Familie mit mehreren Kindern gehabt hätte. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir so hätten weiterleben können.
- Farah: Aber die Rückkehr war doch auch enttäuschend, oder nicht?
- Zeynab: Ich kann mich daran erinnern, dass du sehr sauer auf mich und deinen Vater warst. Du sagtest: Ihr habt mir mit dieser Rückkehr Unrecht angetan.
- Farah: Und du, Mama, wie ging es dir?
- Zeynab: Weißt du, als ich weit weg von zu Hause war, hatte ich immer Sehnsucht nach dem Meer und nach meinen Eltern. Ich habe immer von ihnen geträumt. Außerdem wusste ich nicht, wohin ich sonst sollte. Mein Traum war, dass ich, zurück in Gaza, ein Stück Land kaufe, auf dem ich mein eigenes Haus baue, von dem aus ich aufs Meer blicke.
- Farah: Und dann?
- Zeynab: Es war seltsam: Als ich nach Gaza zurückkehrte, verflog der Wunsch schnell. Ich fand eine andere Stadt vor als die, die ich gekannt hatte. Mit dieser Stadt verband mich nichts mehr. Ich hatte dort keine Freiheiten mehr – der Traum war endgültig zerplatzt.
- Farah: Bereust du, dass wir zurückgegangen sind?
- Zeynab: Nein, das bereue ich nicht. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Und trotzdem: Mittlerweile ist es fünfundzwanzig Jahre her, dass wir zurückgekehrt sind, und doch bleiben die dreizehn Jahre, die ich in Syrien verbracht habe, die besseren. Dort hatte ich ein Gefühl von Freiheit, von Stabilität und Zugehörigkeit. Und am Ende ist diese Rückkehr auch eine politische Enttäuschung, jedes Jahr aufs Neue.
- Farah: Glaubst du, viele denken so wie du?
- Zeynab: Ja, das glaube ich. Wer die Möglichkeit hat, das Land wieder zu verlassen, ergreift sie. Die junge Generation hat es getan. Es gibt aber auch einige, die sich hier niedergelassen, eine Familie gegründet, Arbeit gefunden und sich mit der Situation abgefunden haben. Deine Tante, die aus Ägypten zurückkam, ist so ein Beispiel. Aber in Ägypten ist die Situation auch schwieriger, als sie in Syrien war. Außerdem war ich allein und bin alleine geblieben.
Irgendwann ist meine Mutter müde von der Fragerei, ich auch. Sie wundert sich darüber, dass ich bestimmte Dinge nicht anspreche, bestimmte Geschäfte und Freund*innen nicht erwähne. Sie denkt, das müssten auch meine Erinnerungen sein, aber es sind ihre. Ihre Erinnerungen als Liebende, als Kämpferin und als Mutter. Ich dagegen bin wie jedes Mädchen. Ich wuchs fast normal auf, war die Tochter meiner Mutter, kam auf diese Welt, lebte mit ihr und wanderte gezwungenermaßen mit ihr zusammen aus.
******
Ich bin keine syrische Palästinenserin und ich weiß auch nicht, warum man mich so nennt. Vielleicht liegt es an meinem Dialekt, meinen Interessen und meinem politischen Engagement. Ich bin meistens Palästinenserin (so stelle ich mich vor). Und manchmal Jordanierin (laut Pass und wenn es mir nützlich ist). Nur eines ändert sich nicht: Der Ort, an dem ich geboren wurde – Damaskus in Syrien.
Dieser Geburtsort verfolgt mich auf Schritt und Tritt. An Grenzen werde ich stets gefragt, ob ich einen syrischen Pass besitze. Ich sehe an den Blicken der Grenzbeamten, dass sie mir nicht glauben. Auch bei deutschen Behörden und Institutionen behandelt man mich wie eine syrische Geflüchtete. Deutsche Banken lehnten es ab, dass ich ein Konto eröffne, denn für Länder wie dieses ist der Geburtsort wichtiger als die Staatsangehörigkeit. Bürokratische Systeme können die Komplikationen von migrantischem Leben nicht erfassen. Aber die meisten von uns werden nun mal nicht am selben Ort begraben, an dem wir geboren wurden, und meistens tragen wir nicht die Staatsangehörigkeit unserer Heimatländer.
*******
Vor fünfundzwanzig Jahren bin ich aus dem Flüchtlingslager ausgezogen, im Moment lebe ich in Berlin. Ich denke an die sonderbaren Schicksale, die mich hier mit jungen Menschen zusammengeführt haben, die nach den Aufständen von 2011 aus Syrien und aus dem Flüchtlingslager Jarmouk kamen, und an den Krieg, der anschließend ausbrach, um den Aufstand niederzuschlagen. Wäre ich hier, wenn wir nicht nach Gaza zurückgegangen wären? Wäre es überhaupt möglich gewesen, in Syrien zu bleiben und dort alt zu werden, ohne entsprechende Flüchtlingsdokumente? Wäre ich womöglich bis zur Belagerung des Flüchtlingslagers und der Vertreibung seiner Bewohner*innen in derselben Wohnung geblieben? Ich frage meine Mutter, ob sie sich so etwas vorstellen könnte. Ich habe den Eindruck, dass sie sich nicht einmal vorstellen kann, dass wir in Syrien geblieben wären. Unser Leben war nur so möglich, wie es jetzt ist. Wir waren Gäste und heute sind wir Gäste in Gaza. Wir sind die, die an den Ort zurückkehrten, den sie sich in der Fremde, während Vertreibung und Einsamkeit so nicht vorgestellt und sich auch nicht gewünscht haben.
[1] UNWAR (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten.
*Übersetzung: Mustafa Al Suliman
Dieser Text erschien erstmalig am 17.12.2020 auf Arabisch auf www.aljumhruya.net.



